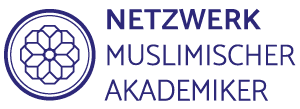Essay: Macht der Machtlosen
Warum Menschen Macht nicht ergreifen – Unsere Schöne Neue Welt
von Ahmet Aygün
Es ist ein archaischer Moment, der die Essenz von Macht offenbart: Der Triumph des Lebenden über den Getöteten, wie es der Schriftsteller Elias Canetti beschreibt. Der Sieger, der seine Überlegenheit feiert, erlebt Macht in ihrer reinsten Form – sichtbar im Akt des Überlebens. Doch dieser Moment erzählt nur eine Seite der Geschichte. Was bleibt, ist die unsichtbare Ohnmacht des Besiegten, eine Stille, die in ihrer Tiefe erdrückend ist. Doch kann man von Ohnmacht sprechen, wenn der Besiegte seiner Situation nicht mehr bewusst ist? Oder beginnt Machtlosigkeit erst dort, wo der eigene Wille spürbar eingeschränkt wird?
Abseits dieser extremen Szenarien erleben wir im Alltag der modernen Welt eine subtilere und veränderte Dialektik zwischen Macht und Ohnmacht. Während in vergangenen Zeiten das Streben nach Macht oft durch Gewalt geprägt war, bieten heutige Gesellschaften andere Wege zur Machterlangung: politische Teilhabe, soziale Anerkennung, wirtschaftliche Sicherheit. Der technische Fortschritt hat den Kampf ums bloße Überleben abgelöst. Dennoch bleibt das Gefühl von Ohnmacht für viele ein beständiger Zustand, obwohl die Wege und Möglichkeiten, Macht zu erlangen, zahlreicher und weniger von körperlicher Stärke abhängig sind. Denn die heutigen Strukturen entwickelter Länder bieten Chancen und Möglichkeiten, Macht zu ergreifen, Ressourcen zu mobilisieren und Einfluss auf das soziale und politische Geschehen zu nehmen – theoretisch für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich. Doch häufig bleiben Individuen und Gruppen in einem Zustand der Ohnmacht, ohne die Mittel zu nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Warum entscheiden sich Menschen, nicht aktiv nach Macht zu streben, und warum verharren sie manchmal sogar bewusst in Machtlosigkeit?
In Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ wird die Frage, warum Menschen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nicht ergreifen, um Macht zu gewinnen, auf beunruhigende Weise dargestellt. Die dystopische Gesellschaft, die Huxley entwirft, illustriert eindrucksvoll, wie eine technologische und ideologische Kontrolle die Menschen in einen Zustand permanenter Machtlosigkeit versetzt. Erstaunlicherweise verspüren die meisten Individuen in dieser Gesellschaft keinerlei Wunsch, aus dieser Machtlosigkeit auszubrechen. Stattdessen akzeptieren sie diese nicht nur, sondern empfinden sie als notwendig für ihr Glück und ihre Stabilität. Huxleys Werk bietet somit ein extremes Beispiel dafür, wie Machtlosigkeit bewusst kultiviert werden kann, um eine scheinbar harmonische, aber tiefgehend kontrollierte Gesellschaft zu schaffen.
Also bleibt das Individuum in einem Zustand der Machtlosigkeit, weil die Gesellschaft so strukturiert ist, dass das Streben nach Macht und Einfluss als unnötig und sogar schädlich angesehen wird. Eine der Hauptursachen für diese passive Akzeptanz ist die umfassende konditionierte Zufriedenheit, die von den Menschen von klein auf eingetrichtert wird. Die Bürger werden nicht nur biologisch, sondern auch psychologisch so geprägt, dass sie ihre vorbestimmten Rollen als „Alphas“, „Betas“, „Gammas“ oder „Epsilons“ als optimal und erstrebenswert betrachten. Diese Prägung führt dazu, dass der Drang, Macht zu ergreifen oder soziale Veränderungen herbeizuführen, als überflüssig und verpönt wahrgenommen wird. Stattdessen begnügen sich die Menschen mit ihrem Leben und den ihnen zugewiesenen Funktionen, die durch ein System von Belohnungen und Bestrafungen stabilisiert werden.
Ein weiterer zentraler Aspekt, warum Menschen in dieser Welt keine Macht ergreifen, ist die omnipräsente Angst vor Unbehagen und Instabilität. Huxleys Gesellschaft hat einen starken Fokus auf Konsum und Genuss, und die Bürger sind darauf trainiert, ihre Emotionen und Bedürfnisse durch Drogen wie „Soma“ zu regulieren. Diese Droge verhindert nicht nur Unruhe und Leid, sondern sorgt auch dafür, dass die Menschen in einem dauerhaften Zustand der Zufriedenheit und Ablenkung bleiben.
Die Mechanismen der Machtlosigkeit, die Huxley beschreibt, finden in unserer modernen Welt durchaus Entsprechung. In Zeiten von Überwachung, Konsumkultur und der ständigen Verfügbarkeit von Informationen sehen sich viele Menschen in einer ähnlichen Situation: Sie können zwar theoretisch Einfluss nehmen, doch häufig werden sie durch soziale Normen, wirtschaftliche Zwänge und die Angst vor Unsicherheit davon abgehalten, aktiv zu werden. Die psychologische Bequemlichkeit, die Huxley schildert, ist auch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft noch präsent, wenn es darum geht, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen oder gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.
“They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions, and his physiology even, and so, making him actually love his slavery.”¹
Um die Frage zu beantworten, warum Menschen nicht nur unreflektiert in einem Zustand der Ohnmacht verharren, sondern manchmal auch bewusst Macht nicht ergreifen wollen, lässt sich auf unterschiedliche Mechanismen zurückführen, die sowohl individuell als auch strukturell wirken. In modernen Gesellschaften ist Macht stark institutionalisiert, und Individuen sind Teil großer, hierarchischer Systeme, in denen Entscheidungen stufenweise von oben nach unten durchgesetzt werden. Bürokratien zeichnen sich durch eine Vielzahl von Regeln, Vorschriften und eine strikte Arbeitsteilung aus, was dazu führt, dass der Einzelne kaum direkten Einfluss auf Entscheidungsprozesse hat. Die Rationalität und Effizienz dieser Strukturen bewirken, dass Menschen sich in ihre festgelegten Rollen einfügen – als funktionierendes Zahnrad einer komplexen Maschinerie. Durch die auf dem Arbeitsplatz wirkende Disziplinarmacht fühlt sich der Einzelne innerhalb dieser starren Strukturen oft machtlos und resigniert, da kontrollierte Macht hier als etwas unsichtbares erscheint, dem man überall ausgesetzt ist. Nach Feierabend tritt der Einzelne in eine Umgebung ein, die durch ständige Ablenkungen in Form von Konsum, Unterhaltung und einer allgegenwärtigen Informationsflut geprägt ist. Es erscheint bequemer, in der persönlichen Komfortzone zu verharren, anstatt sich dem Unbehagen und den Risiken zu stellen, die soziales Engagement und die Auseinandersetzung mit Machtkämpfen mit sich bringen.
Dass Macht tatsächlich nicht nur “von oben” kommt, sondern in den Situationen von Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten Ausdruck findet, spiegelt sich auch in der Auffassung des Philosophen und Historikers Michel Foucault wider, welcher bekannt ist für seine Machtanalyse. Nach seiner Theorie erscheint die Macht im modernen Staat in einer dezentralisierten Form, die eher wie ein allumfassendes Netz wirkt. Die Macht ist nicht mehr traditionell in den Händen eines Souveräns oder einer einzelnen Institution gebündelt, sondern “vollzieht sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen“². Diese Netzwerke der Macht, welcher Foucault als Disposition bezeichnet, sind für ihn nicht nur Ausdrücke der Repression, sondern auch Strategien zur Formung und Gestaltung von Individuen. Macht ist also produktiv. In dem verschiedene Instanzen – wie Polizei, Bildung und Justiz, aber auch kulturelle Normen und Diskurse – miteinander verbunden sind, lenkt der Staat weniger durch offene Gewalt oder sichtbaren Zwang, sondern vielmehr durch subtile Mechanismen der Disziplinierung, die tief in das alltägliche Leben eingreifen. Diese Mechanismen etablieren gesellschaftliche Normen sowie Vorstellungen davon, was „normal“ oder „richtig“ ist.
„Die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt.“³
Wir verstehen Macht nicht als etwas, dem wir entkommen können. Stattdessen ist es so, dass wir uns nie gänzlich aus Machtstrukturen zurückziehen können; wir wechseln lediglich von einer Struktur zur nächsten. Das Einzige, was wir tatsächlich erreichen können, ist die Machtbeziehung zu verändern, umzukehren oder zu verlagern. Dies kann sogar bedeuten, dass wir unsere eigene Machtstruktur bewusst oder unbewusst aufbauen. Wir färben die Macht und nehmen Teil an den Wechselwirkungen, die unser Leben prägen. Letztendlich ist Macht etwas, das allgegenwärtig zu sein scheint, unabhängig davon, wer sie ausübt und wer nicht.
Die Kontrolle und Zufriedenheit, die in Huxleys dystopischer Gesellschaft kultiviert werden, schaffen nicht nur Unfreiheit, sondern auch eine Form von Glück und Stabilität, die von vielen als höherer Wert angesehen wird. Der Zwang zur aktiven Teilhabe kann eine Belastung sein, und ein Streben nach individueller Macht könnte das Bedürfnis nach Ruhe und innerem Frieden kompromittieren. Gesellschaftliche Diskurse, Institutionen und Normen prägen die Wahrnehmung der Menschen und erwecken den Eindruck, dass sie keine Macht besitzen – eine Illusion, die durch Konsum und Ablenkung verstärkt wird, die zugrunde liegenden Mechanismen der Kontrolle zu erkennen oder zu hinterfragen. Das Hinterfragen der eigenen Ohnmacht wird also von vornherein dadurch erschwert, dass eine tiefe Entfremdung und ein mangelndes Bewusstsein für eigene Handlungsmöglichkeiten besteht. Der ohnmächtige Mensch müsse sich also in einem neuen, übergeordneten Zustand wiederfinden, um dieses Gefühl der Machtlosigkeit abzulegen. Dieser übergeordnete Zustand könnte darin bestehen, dass Menschen ihre Handlungsmöglichkeiten erkennen, ohne sie zwanghaft ausüben zu müssen, und zugleich die Sicherheit und Stabilität zu schätzen wissen, die durch disziplinierende Strukturen geboten werden. Es erfordert, sich bewusst zu machen, welchen Einflüssen man ausgesetzt ist, und mit gestärktem Willen die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, anstatt sich fremdbestimmt lenken zu lassen. Doch wie kann der Mensch diesen übergeordneten Zustand dauerhaft und nachhaltig erreichen?
Letztlich ist eines klar: sich aus diesem Netz der Machtbeziehung zu befreien, scheint unmöglich zu sein, denn dies ist, wie auch Foucault bekräftigt, eine historische Tatsache der modernen Gesellschaft und kann nicht durch einen einfachen Akt der Befreiung aufgelöst werden. Stattdessen könnte die Reflexion über diese Machtstrukturen und eine bewusste Haltung ihnen gegenüber eine Form von Freiheit darstellen, die nicht auf vollständiger Unabhängigkeit beruht, sondern auf einer bewussten und friedlichen Integration in das gesellschaftliche Gefüge. Auf diese Weise verbleibt die Ohnmacht nicht mehr als Dauerzustand und der Mensch kann seine Entscheidungen auch als “seine” ansehen. Wirkliche Freiheit liegt nicht in der Illusion, sich aus Machtstrukturen vollständig lösen zu können, sondern in der Fähigkeit, sich ihrer bewusst zu werden und sie konstruktiv zu gestalten. Die gegenwärtige, modernisierte Gesellschaft, wie sie insbesondere in Großstädten anzutreffen ist, bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Einerseits kann sie durch Informationsüberflutung und schnelle Lebensrhythmen das Gefühl von Kontrolle mindern und so zu Passivität und Ohnmacht führen. Andererseits eröffnet sie zahlreiche Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Einflussnahme. Beispiele hierfür sind die Nutzung sozialer Medien, flexible Arbeitsmodelle und innovative Bildungswege, die den Menschen neue Freiheiten und Gestaltungsspielräume bieten.
Ob sich eine Balance zwischen Anpassung und Veränderung, zwischen Abhängigkeit und Gestaltungskraft finden lässt, hängt davon ab, ob der Mensch bereit ist, sein Verständnis vom angestrebten Glück kritisch zu hinterfragen. Soll das angestrebte Glück auf der Maximierung von Lust und der Vermeidung von Leid basieren, oder vielmehr auf persönlicher Weiterentwicklung und der Verwirklichung eines höheren Lebenssinns? Es bleibt die zentrale Frage, wonach der Mensch strebt und wie er seine Potenziale zur Gestaltung seiner Welt nutzt.
Einzelnachweise
- https://www.youtube.com/watch?v=hKvZdKQG8wU Zugriff: 1.11
- Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit, Erster Band. Der Wille zum Wissen. Aus dem Französischen v. Ulrich Raulff u. Walter Seitter, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977, S. 115
- Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit, Erster Band. Der Wille zum Wissen. Aus dem Französischen v. Ulrich Raulff u. Walter Seitter, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977, S. 114
Literatur
- Huxley, Aldous. (2014): Schöne neue Welt. Fischer Verlag
- Foucault, Michel (2022): Überwachen und Strafen. Suhrkamp Verlag
Über Uns
Unsere Projekte
© Copyright by Netzwerk Muslimischer Akademiker.